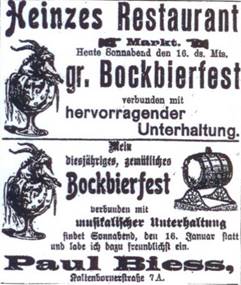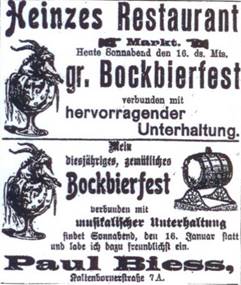
Gebrauch aus alter Zeit: In Görlitz wurde dieser Tage der Vater eines von der Strafkammer Verurteilten in eine sofort vollstreckbare Ungebührstrafe von zwei Tagen genommen, weil er - im Zuhörerraume befindlich - nach Schluß der Verhandlung die Auflage als eine Lüge bezeichnet hatte. Beim Lesen dieser Tatsache wurden wir an einen alten Brauch erinnert, über welchen der Professor Dr. Sausse, seinerzeit Prorektor des Gymnasiums zu Guben, im Osterprogramm 1864 wie folgt berichtete: "Der Gubener Bürger und Schiffer Elias Schockvar wurde 1531 wegen wörtlicher Beleidigung gestraft, weil er, in einem Rechtshandel unterlegen, aus Ärger darüber zu unpassender Zeit vor Bauern auf dem Markte, den Stadtrichter, welcher ihn verurteilt hatte, gescholten hatte. Es geschah dies am Montage nach der Sonnabends erfolgten Verurteilung, also "zu unpassender Zeit", weil altem, gubischem Gebrauche gemäß der Verurteilte seinen Ärger über den Richter, der ihn verurteilt hatte, 24 Stunden lang nach der erfolgten Verurteilung, aber nicht eine Minute länger, in Schelten und Schmähen auslassen durfte. Diesen wunderlichen Gebrauch, der - wie ich auf einer Reise vor ungefähr 47 Jahren gehört zu haben ich mich erinnere - auch in südlichen Gauen Deutschlands und in der deutschen Schweiz einst bekannt gewesen sein soll, schaffte die kursächsische Regierung um 1650 ab, indem sie dem Rat der Stadt Guben wider dessen Gutachten und Wissen nötigte, jede gegen einen Richter vom Verurteilten ausgestoßenen Schmähung, gleichviel zu welcher Zeit, als eine Beleidigung des unantastbaren richterlichen Amts zu strafen. Der Rat hielt für besser, daß der Verurteilte 24 Stunden hindurch seinem Ärger offen Luft machte, als längere Zeit in geheimen Verdächtigungen und üblen Nachreden, die wegen Mangels an willigen Zeugen nicht leicht gerügt werden könnten." - Professor Sausse fügte am Schlusse seiner Mitteilung folgende lakonische Bemerkung hinzu: " Solche Freisinnigkeit des Rates wird im Laufe des 18. Jahrhunderts vermißt."
Die Niederlausitzer Tuchfabrikation zu Anfang des Jahrhunderts
Zu diesem, vor einigen Tagen besprochenen Thema wird im Forst. Tagebl. geschrieben: Guben hatte im Jahre 180 bei 5214 Einwohnern 98 Tuchmacher (wovon 55 auf eigenen Rechnung, 18 für Lohn und 25 als Gesellen arbeiteten), 7 Tuchbereiter und 4 Färber. In Spremberg hantierten bei 1800 Einwohnern 84 Tuchmacher, 40 Tuchknappen und 6 Tuchscherer. Die Tuchmacher vertrieben ihre Waren auf den Leipziger und Braunschweiger Messen und auch im Auslande, besonders nach Triest. Von 1794 bis 99 fertigte man über 112300 Stück. Viele der ärmeren Bewohner lebten nur von den Arbeiten für die Tuchmacher. Sorau mit 3454 Einwohnern beschäftigte 80 Tuchmachermeister mit einer ziemlichen Anzahl Gesellen. Jährlich wurden gegen 2600 Stück des Stück am Werte von 20 Talern gefertigt. Von 1794-99 lieferte Sorau über 12100 Stück. Außer den Meistern lieferte die Petrische Manufaktur (eine Art Fabrik), die 100 Menschen beschäftigte jährlich 2 bis 300 feine Tuche. Die meisten Tuche gingen nach Italien, durch die Leipziger Messe durch ganz Deutschland, nach Schweden, Rußland und selbst nach Nordamerika. Den jährlichen Bedarf an Wolle schätzte man auf 4000 Stein (1 Stein = 20 Pfund). Sie wurde größtenteils aus Südpreußen bezogen. Der Wollhandel gehörte deshalb zu den bedeutendsten Erwerbszweigen von Sorau und wurde am stärksten von Kaufmann Uhse betrieben. In Kirchhain fertigten 18 Tuchmacher und 3 Tuchscherer von 1794-99 3500 Stück Tuche. Forst, das später zur größten Tuchfabrikstadt Deutschlands aufblühte, hatte im Jahre 11798: 1393 Einwohner, davon waren 19 Tuchmacher mit 12 Stühlen und 34 Leineweber mit 46 Stühlen. Von der Wollspinnerei für in- und auswärtige Tuchmacher nährten sich besonders viele Frauen.